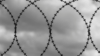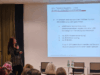Flucht und Be_Hinderung
Unsichtbare Barrieren auf der Suche nach Sicherheit
Ein Artikel von Tessa Kayser
Situation in Kriegs- und Kriesengebieten
Menschen mit Be_hinderungen stehen in Kriegs- und Krisengebieten oft vor lebensbedrohlichen Herausforderungen. Der Zugang zu medizinischer Versorgung und notwendiger Betreuung ist stark eingeschränkt oder ganz unterbrochen. Zerstörte Straßen und fehlende Infrastruktur machen es schwer, Menschen mit Be_hinderungen überhaupt zu err-eichen. Gleichzeitig fehlen oft klare Pläne und Informationen, wie eine sichere Evakuierung für sie organisiert werden kann. Hinzu kommt: Für einige ist es schwer zu erkennen, dass sie sich in einer akuten Gefahrensituation befinden – etwa, wenn Warnsirenen wegen einer Hörbe_hinderung nicht wahrgenommen werden oder die Brisanz der Lage aufgrund einer psychischen Be_hinderung nicht richtig eingeschätzt werden kann. Luftschutzbunker und Notunterkünfte sind in der Regel nicht barrierefrei, und es gibt kaum geeignete Orte, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit Be_hinderungen ausgerichtet sind. Hinzu kommt eine enorme psychische Belastung, die durch die Unsicherheit, Isolation und das Fehlen unterstützender Strukturen noch verstärkt wird.
Herausforderungen während der Flucht
Für viele Menschen mit Be_hinderungen ist die Flucht aus einem Kriegsgebiet mit großer Unsicherheit verbunden. Oft ist unklar, ob die Fluchtrouten barrierefrei sind, wie weit der Weg ist oder ob unterwegs medizinische Versorgung verfügbar ist. Diese Ungewissheit, kombiniert mit chaotischen und gefährlichen Zuständen, führt dazu, dass sich viele eine Flucht gar nicht erst zutrauen. Selbst ehemals barrierefreie Wege können durch Zerstörung unpassierbar geworden sein. Häufig fehlt es an Unterstützungspersonen, die während der Flucht helfen könnten, und an grundlegenden Hilfsmitteln wie Rollstühlen oder Gehhilfen. Der enorme psychische Stress und die ständige Unsicherheit belasten zusätzlich. Für einige Kinder mit Be_hinderungen ist die Situation besonders herausfordernd, da es vorkommen kann, dass sie während der Flucht von ihrer Familie oder Betreuungspersonen getrennt werden und anschließend in überfüllten Einrichtungen untergebracht sind.
Diese Herausforderungen stellen nur einen Teil der Probleme da. Jede Flucht ist individuell, weshalb die Menschen verschiedenen, teilweise auch nicht aufgeführten, Herausforderungen gegenüberstehen. Zudem ist es schwierig eine klare Abgrenzung zwischen den beiden Bereichen zu ziehen, da einige Aspekte sowohl auf der Flucht als auch im Kriegsgebiet Auswirkungen haben.
Rechtliche Grundlagen in Deutschland
Die rechtliche Grundlage für den Umgang mit schutzbedürftigen Geflüchteten ist die EU-Aufnahmerichtlinie für Schutzsuchende (2013/33/EU). In dieser Richtlinie steht in Artikel 21 geschrieben: „Die Mitgliedstaaten berücksichtigen in dem einzelstaatlichen Recht zur Umsetzung dieser Richtlinie die spezielle Situation von schutzbedürftigen Personen wie Minderjährigen, […] Behinderten […].“ Etwa 15 % der geflüchteten Menschen haben eine chronische Krankheit oder Behinderung, wobei NGO’s von bis zu 2 Millionen Betroffenen ausgehen. Diese Menschen haben besondere Bedürfnisse und Rechte, die im Aufnahmeland berücksichtigt werden müssen. Deutschland hat sich mit der UN-BRK (2009) zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen verpflichtet. Der Teilhabebericht 2016 zeigte jedoch Defizite, insbesondere im Zugang zur Arbeit, sozialen Beziehungen und der Vermeidung von Isolation. Außerdem bestimmt der Aufenthaltsstatus maßgeblich den Zugang zu Unterstützung: Erst mit einem gesicherten Aufenthaltstitel bestehen gleiche sozialrechtliche Ansprüche wie bei einer deutschen Staatsbürger:innenschaft.
Herausforderungen in Deutschland
Bei der Ankunft von Geflüchteten werden Be_Hinderungen nicht festgestellt. Alle Menschen werden pauschal als „Geflüchtete“ behandelt, ohne auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Der Ankunftsprozess verläuft meist chaotisch, und es gibt wenig Informationen darüber, wie man Unterstützung erhält. Zudem sind Sammelunterkünfte in der Regel weder barrierefrei noch bieten sie Privatsphäre, was ein stabiles und angenehmes Umfeld erschwert. Diese Bedingungen stellen eine zusätzliche Belastung dar, vor allem für Menschen, die auf einen gleichbleibenden Tagesablauf angewiesen sind. Sprachbarrieren erschweren ärztliche Behandlungen 3 und Behördengänge, wobei auch Dolmetscher:innen für fremde Gebärdensprachen oft notwendig sind. Des Weiteren gestaltet sich die Suche nach Ärzt:innen für Untersuchungen ohne Registrierung schwierig, sind aber für beispielsweise verschreibungspflichtige Medikamente essenziell. Außerdem muss der Transport für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu Arztpraxen organisiert und Informationen über die Zugänglichkeit von Gebäuden bereitgestellt werden. Eine weitere Herausforderung stellt das Ausfüllen von Anträgen dar. Diese müssen aus eigener Initiative ausgefüllt und in deutscher Sprache eingereicht werden, was durch die komplexe Struktur der Behörden und Ämter erschwert wird (Komm-Strukturen). Die Unterstützung von Seiten der Stadt und Politik ist zu gering, wodurch zivilgesellschaftliches Engagement notwendig wird, um Hilfe anzubieten – was ein systemisches Problem widerspiegelt.
Handicap International / Humanity & Inclusion (HI)
Handicap International / Humanity & Inclusion (HI) ist eine gemeinnützige Organisation, die in rund 60 Ländern weltweit aktiv ist. Sie setzt sich für eine inklusive und solidarische Gesellschaft ein – insbesondere für Menschen mit Be_hinderung und andere schutzbedürftige Gruppen in Krisen- und Kriegsgebieten. Die Organisation engagiert sich in der Katastrophen- und Flüchtlingshilfe, für barrierefreie medizinische Versorgung, Rehabilitation, Teilhabe sowie für eine Welt ohne Minen und Streubomben. Als Mitbegründerin der internationalen Landminenkampagne wurde HI 1997 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Handicap International e.V. ist der deutsche Verein der Organisation.
Ein wichtiges Projekt in Deutschland ist Crossroads. Es unterstützt geflüchtete Menschen mit Be_hinderung dabei, ihre Rechte und die vorhandenen Hilfsangebote kennenzulernen und wahrzunehmen. Gleichzeitig berät und schult das Projekt Fachkräfte aus der Flüchtlings- und Behindertenhilfe, fördert die Vernetzung beider Bereiche und setzt sich politisch für mehr Inklusion im Asylsystem ein. Ziel ist, dass die spezifischen Bedürfnisse geflüchteter Menschen mit Be_hinderung systematisch berücksichtigt werden – von der Erstaufnahme bis zur Integration.
Erklärung der Schreibweise
Das Wort Be_Hinderung mit einer Lücke und einem großen H zu schreiben ist eine bewusste Entscheidung. Hiermit soll verdeutlicht werden, dass keine Person „behindert ist“, sondern von ihrem Umfeld in ihrer Lebensweise be_Hindert wird. Diese Hindernisse stellen Gebäude, Treppen oder sonstige Strukturen da. Der Slogan „behindert ist man nicht- behindert wird man“ von Be_Hindertenrechtsaktivist*innen fasst dies nochmal kurz und bündig zusammen. Zudem soll die Stigmatisierung von „den Behinderten“ aufgebrochen werden. Es gibt nicht die*den eine*n Be_Hinderte*n. Menschen sind nicht nur durch ihre Be_Hinderung charakterisiert, sondern haben zahlreiche Eigenschaften darunter eben auch eine Be_Hinderung.
Quellen
Aktion Mensch: Flucht mit Behinderung: „Die Menschen sind häufig unterversorgt“. Online unter: https://www.aktion-mensch.de/inklusion/recht/zugang-zum-recht/flucht-und-behinderung (zuletzt aufgerufen am 30.09.25).
Amtsblatt der Europäischen Union: Richtline 2013/33/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013. Online unter: https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/Gesetzestexte/Aenderungs_AufnahmeRL.pdf (zuletzt aufgerufen am 30.09.25).
Barriere:zonen: Leben und Überleben mit Behinderung weltweit. Online unter: https://www.barriere-zonen.org/ (zuletzt aufgerufen am 30.09.25).
Bundeszentrale für politische Bildung: Barrieren der gesellschaftlichen Teilhabe im Schnittfeld Behinderung und Migration/Flucht. Online unter: https://www.bpb.de/themen/inklusion-teilhabe/behinderungen/539996/barrieren-der-gesellschaftlichen-teilhabe-im-schnittfeld-behinderung-und-migration-flucht/ (zuletzt aufgerufen am 30.09.25).
Die neue Norm (2022): Krieg in der Ukraine. Online unter: https://dieneuenorm.de/podcast/krieg-inder-ukraine/ (zuletzt aufgerufen am 30.09.25).
Familienratgeber: Flucht und Behinderung. Online unter: https://www.familienratgeber.de/beratung-hilfen/beratungsangebote/flucht-und-behinderung (zuletzt aufgerufen am 30.09.25).
Handicap international. Online unter: https://www.handicap-international.de/ (zuletzt aufgerufen am 30.09.25).
Handicap international/Crossroads. Online unter: https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/ (zuletzt aufgerufen am 30.09.25).
MINA-Leben in Vielfalt e.V. (2021): Unsere Wege. Erfahrungsberichte geflüchteter und migrierter Familien mit Kindern mit Behinderung. Berlin.
Missy Magazin: Hä, was heißt denn be_hindert?Online unter:https://missy-magazine.de/blog/2019/03/12/hae-was-bedeutet-be_hindert/(zuletzt aufgerufen am 30.09.25).
Foto von engin akyurt auf Unsplash