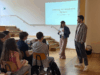Versicherheitlichung: Wenn Migration zur Sicherheitsfrage gemacht wird
Versicherheitlichung – Wenn Migration zur Sicherheitsfrage gemacht wird
Ein Artikel von Sena Temel
Migration wird zunehmend als Sicherheitsproblem behandelt- man kann es an der EU-Grenzpolitik und auch in öffentlichen Debatten erkennen. Den Prozess kann man auch Versicherheitlichung nennen.
Aber was bedeutet Versicherheitlichung? Wie wird Migration versicherheitlicht? Und wie wirken sich die Maßnahmen aus? Hierbei spielen vor allem Machtstrukturen und Rassismus eine Rolle.
Was bedeutet Versicherheitlichung?
Versicherheitlichung bedeutet, dass etwas, in diesem Fall die Migration, als Sicherheitsproblem bezeichnet wird und dadurch die politischen Maßnahamen angeregt werden, mit denen man dieses Problem in Angriff nimmt. Das heißt, ein Thema wird zur Bedrohung erklärt, um außergewöhnliche Maßnahmen zu legitimieren, die auf Bekämpfung der vermeintlichen Bedrohung abzielen. Dabei wird Migration häufig in Rahmen von Bedrohungen wie Terrorismus, Gefährdung kultureller Identität und Kriminalität diskutiert. Das Ziel der „versicherheitlichten“ Migrationspolitik ist es, Migrationsbewegungen zu stoppen oder zu unterbrechen.
Zum Beispiel wurde nach dem Anschlag in Solingen die Debatte um irreguläre Migration und Abschiebungen an den deutschen Außengrenzen größer. Die Versicherheitlichung, also die Darstellung der Migrant*innen als Bedrohung sollte in diesem Fall die Grenzkontrollen innerhalb europäischer Grenzen, trotz gemeinsamer Regeln und Einschränkungen im Schengenraum, legitimieren. Diese Diskussionen sind aber nicht neu. Das Thema Migration im Zusammenhang mit Sicherheit wird schon lange in den Medien mal stärker und mal weniger stark thematisiert. 2015 wurde zum Beispiel von der „Flüchtlingskrise“ gesprochen, welches eine negative Kontierung ist und suggeriert, dass Geflüchtete selbst das Problem darstellen, anstatt die humanitäre Notlage und die politischen Herausforderungen in den Vordergrund zu stellen.
Wie wird die Migration versicherheitlicht?
Es gibt unterschiedliche Methoden, diesen Prozess zu erklären. Eine davon ist die Kopenhagener Schule von Berry Buzan, Ole Waever und Jaap de Wilde, die behaupten, dass die Migration durch politische Akteure zu einer Bedrohung gemacht wird:
- Benennung der Bedrohung: Ein einflussreicher Politiker oder eine andere Eliteperson bezeichnet Migration als existentielle Bedrohung für das Publikum.
- Anerkennung durch das Publikum: Damit Maßnahmen legitimiert werden, muss die Bedrohung von der Öffentlichkeit als real wahrgenommen werden. Dies hängt von bereits vorhandenen Vorurteilen, gesellschaftlichen Einstellungen oder aktuellen Ereignissen (z. B. Anschlägen) ab. Auch Konstruktionen von Nationen, Sicherheit und kultureller Identität spielen eine Rolle.
- Legitimierung außergewöhnlicher Maßnahmen: Nach der Anerkennung wird es möglich, außergewöhnliche Gegenmaßnahmen einzuführen, z. B. Grenzschließungen, Pushbacks, Gesetzesverschärfungen oder sogenannte „Sicherheitspakete“.
Was sind die Auswirkungen?
Versicherheitlichung schafft die Rechtfertigung, dass der Staat Sicherheitsregime einführen darf. Das sind zum Beispiel Geflüchteten Lager, Grenzschutz oder auch die Kontrolle der Bewegung von Geflüchteten.
Es geht darum, wie Menschen und Bevölkerungen gelenkt und kategorisiert werden. Durch Asylverfahren, Dublin-Reglungen, Camps an den Außengrenzen, Karten zum Einkaufen oder die biometrische Erfassung wird Migration nicht einfach verhindert, sondern verwaltet und sortiert. Staaten produzieren außerdem bestimmte Kategorien von Migrant*innen wie zum Beispiel „Asylberechtigte“, „Illegale“, „gute“ und „schlechte“ Migrantinnen, um zu legitimieren, wer Schutz, Rechte und Mobilität erhält und wer ausgeschlossen wird. Diese Kategorisierung dient also auch der Macht- und Herrschaftsausübung. Sie legt fest, wessen Leben als schützenswert gilt und wessen nicht. Dadurch wird Migration nicht als menschliche Realität, sondern als Sicherheitsproblem und Verwaltungsaufgabe behandelt, bei der Menschen in verschiedene rechtliche und moralische Klasseneingeteilt werden.
Migration ist nicht „objektiv gefährlich“, die Bedrohung wird erst durch politische Sprache und Machttechniken konstruiert. Diese Versicherheitlichung hat direkte Konsequenzen für demokratische Prinzipien: Indem Migration als außerordentliche Gefahr dargestellt wird, werden politische Maßnahmen gerechtfertigt, die oft die Achtung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Gleichbehandlung untergraben. Grenzschließungen, Pushbacks oder verschärfte Gesetze betreffen häufig die verwundbarsten Menschen und setzen gesellschaftliche Vorurteile in Politik um.
In einer Demokratie sollte Politik auf offenen Entscheidungsprozessen, klaren Gesetzen und der Achtung gegenüber jedem Menschen beruhen – nicht auf Angst oder dem Bild einer ständigen Bedrohung. Die Versicherheitlichung macht deutlich, wie schnell politische Sprache dazu führen kann, dass Gleichbehandlung und demokratische Werte in den Hintergrund geraten.
Literatur, die verwendet wurde oder zur Vertiefung dient:
Helmes J. (2020): Die Versicherheitlichung der Migration in den USA. Eine Redeanalyse des US-Präsidenten Donald Trump. Center für Global Studies- Student Papers. Universität Bonn.
Wendekamm M. (2015): Die Wahrnehmung von Migration als Bedrohung. Zur Verzahnung der Politikfelder Innere Sicherheit und Migrationspolitik. Springer VS. Wiesbaden. (Kapitel 10, S. 204-222)
Grieb-Viglialoro C. (2022): Literatur zwischen Biopolitik und Migration. Dispositive in der frankophonen Gegenwartliteratur. Transcript Verlag. Bielefeld. (S. 21-31)
Banai A. & Kreide R. (2017): Versicherheitlichung der Migration in Deutschland: die Zwiespältigkeit von Staatsbürgerschafts- und Menschenrechten. In Zfmr (Bd. 2, S. 30-53)
Marquardt N. (2022): Michel Foucault- Gouvernmentalität und Stadt. In: Belina B., Naumann M. & Strüver A. (Hrsg.): Handbuch kritische Stadtgeographie. Westfälisches Dampfboot Verlag, Münster.
Schindel E. (2022): Essay: Versicherheitlichung versus humanitäre Rettung? Ambivalenzen des EU Grenzregimes und biopolitische Gouvernmentalität. Themenportal Europäische Geschichte. Online unter: https://www.europa.clio-online.de/sites/europa.clioonline/files/documents/B2022/E_Schindel_Versicherheitlichung.pdf